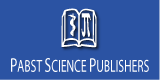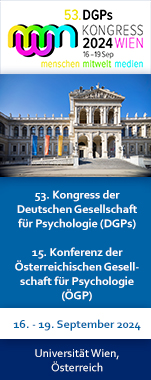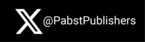Editorial
Friederike Otto
Seelische und körperliche Belastung von Müttern und Vätern in Deutschland - Ergebnisse der GEDA-Studie 2009 und 2010
Elena von der Lippe, Petra Rattay
Kurzfassung
Gratifikationskrisen in der Haus- und Familienarbeit - Gibt es Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Müttern?
Stefanie Sperlich
Kurzfassung
Gesünder nach der Kur? Analyse von GKV-Daten mit Vorher-Nachher-Vergleich für Teilnehmerinnen einer Mutter-Kind-Maßnahme und Mütter ohne Kurbewilligung
Jelena Jaunzeme, Friederike Otto, Siegfried Geyer
Kurzfassung
Nachsorge als Bestandteil der therapeutischen Kette im Rahmen von Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen nach §24 und §41 SGB V
Kati Mozygemba
Kurzfassung
Mütter mit chronischen Rückenschmerzen: Nachhaltigkeit der Behandlung in Mutter-Kind-Kliniken
Dorothee Noeres, Friederike Otto
Kurzfassung
Adipositasbehandlung und Sportverhalten nach einer Mutter-Kind-Maßnahme
Felix Barre, Friederike Otto
Kurzfassung
Veränderung des Patientenprofils in Mutter-Kind-Kliniken 2000-2011
Friederike Otto
Kurzfassung
Separatum
"Man muss natürlich auch was dafür tun
" - Worauf kardiologische Rehabilitanden den Erfolg der Rehabilitationsmaßnahme zurückführen
Erika Schmidt, Antje Ullrich, Erik Farin, Manuela Glattacker
Kurzfassung
Seelische und körperliche Belastung von Müttern und Vätern in Deutschland - Ergebnisse der GEDA-Studie 2009 und 2010
Elena von der Lippe, Petra Rattay
Kurzfassung
Sind Mütter und Väter häufiger oder seltener seelisch und körperlich belastet als Frauen und Männer, die in kinderlosen Haushalten leben? Welche Bedeutung kommen Anzahl und Alter der Kinder, Partnerschaft, Erwerbs- und Sozialstatus sowie sozialer Unterstützung für eine starke seelische und körperliche Belastung von Müttern und Vätern zu?
Die Analyse basiert auf repräsentativen Daten von 32.129 Personen (18-59 Jahre), die vom Robert-Koch-Institut im Rahmen der GEDA-Studie 2009/2010 mittels Telefoninterviews erhoben wurden. Es wurden zum einen Prävalenzen für Frauen und Männer stratifiziert nach dem Zusammenleben mit Kindern berechnet. Zum anderen erfolgte eine Quantifizierung der Bedeutung der Einflussgrößen mittels logistischer Regressionen.
13,5% der Mütter und 7,8% der Väter fühlen sich stark seelisch belastet. Die Prävalenzen für Kinderlose liegen geringfügig, aber nicht signifikant höher. Von starken körperlichen Belastungen sind 11,2% der Mütter und 8,4% der Väter betroffen. Während bei Männern keine signifikanten Unterschiede nach dem Zusammenleben mit Kindern bestehen, fühlen sich Frauen mit Kindern seltener stark körperlich belastet als Frauen ohne Kinder. Risikofaktoren für starke seelische und körperliche Belastungen von Müttern und Vätern stellen ein niedriger Sozialstatus, eine geringe soziale Unterstützung und das Fehlen eines Partners im Haushalt dar. Auch das Nichtnachgehen einer Erwerbstätigkeit führt bei Vätern zu einer starken Belastungserhöhung, während in Teilzeit erwerbstätige Mütter signifikant seltener seelisch belastet sind als Vollzeit- oder Nichterwerbstätige. Auch Mütter mit einem Kind unter drei Jahren fühlen sich signifikant seltener stark belastet. Bei Vätern führt ein Alter von elf bis 13 Jahren des jüngsten Kindes zu einer Risikoerhöhung.
Die Ergebnisse belegen, dass sich Frauen und Männer mit und ohne Kinder mit Blick auf starke seelische und körperliche Belastungen nur geringfügig unterscheiden. Hierfür spielen vermutlich sowohl Selektions- als auch Kausalitätseffekte eine Rolle. So ist anzunehmen, dass weniger stark belastete Frauen und Männer eher eine Familie gründen als stark belastete. Gleichzeitig ist zu vermuten, dass das Zusammenleben mit Kindern sowohl einen Zugewinn an Lebensqualität als auch ein Mehr an Stress bedeuten kann. Die Ergebnisse umreißen ferner die Zielgruppe für Maßnahmen zur Verbesserung der seelischen und körperlichen Gesundheit von Müttern und Vätern.
Schlüsselwörter: seelische Belastung, körperliche Belastung, Gesundheit, Lebensformen, Eltern
Elena von der Lippe
Robert Koch-Institut
Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring
General Pape-Str. 62-66
12101 Berlin
E-Mail: E.vonderLippe@rki.de
Petra Rattay
Robert Koch-Institut
Abteilung für Epidemiologie und Gesundheitsmonitoring
General Pape-Str. 62-66
12101 Berlin
E-Mail: P.Rattay@rki.de
Gratifikationskrisen in der Haus- und Familienarbeit - Gibt es Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Müttern?
Stefanie Sperlich
Kurzfassung
Hintergrund: Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung steht die Frage, ob sich ost- und westdeutsche Mütter im Ausmaß von Gratifikationskrisen in der Haus- und Familienarbeit unterscheiden und wenn ja, ob diese Differenzen durch soziale, familiäre und berufliche Einflussfaktoren erklärt werden können.
Methode: Der aus dem beruflichen Kontext stammende und auf den Bereich der Haus- und Familienarbeit adaptierte Gratifikationskrisen-Fragebogen wurde an einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe von Müttern minderjähriger Kinder aus den alten (n=2582) und neuen Bundesländern (n=433) eingesetzt. Dieser enthält Fragen zu Arbeitsanforderungen und zu potenziellen Belohnungen der Haus- und Familienarbeit. Die Analyse des Einflusses sozialstruktureller Faktoren auf mögliche Ost-West-Unterschiede im Gratifikationskrisenrisiko im Sinne eines Mediator-Effektes erfolgte nach Baron und Kenny (1986) im Rahmen von aufeinander aufbauenden logistischen Regressionsanalysen.
Ergebnisse: Eine Gratifikationskrise im Tätigkeitsfeld Haushalt und Familie lag bei 20,3% der westdeutschen, hingegen nur bei 13,5% der ostdeutschen Frauen vor. Differenzierte Analysen ergaben, dass westdeutsche Frauen vor allem größere Belastungen durch die fehlende Belohnung der Haus- und Familienarbeit angaben. Das Ausmaß der Verausgabung in der Haus- und Familienarbeit sowie die Angaben zur Verausgabungsneigung (Overcommitment) unterschieden sich hingegen zwischen ost- und westdeutschen Müttern kaum. Sozialstrukturelle Faktoren variierten systematisch in Abhängigkeit vom Ost-West-Status der Mütter und übten ihrerseits einen signifikanten Effekt auf das Gratifikationskrisenrisiko aus. Von den untersuchten Einflussfaktoren erwiesen sich insbesondere die Erwerbssituation, der Schulabschluss und die partnerschaftliche Aufgabenteilung als bedeutsame Mediatoren für die ermittelten Ost-West-Unterschiede im Gratifikationskrisenrisiko.
Diskussion: Westdeutsche Mütter weisen im Vergleich zu ostdeutschen Müttern deutlich häufiger eine Gratifikationskrise auf, die auf eine geringere Wahrnehmung der Belohnung der Hausfrauen- und Mutterrolle zurückzuführen ist. Familiäre und sozialstrukturelle Merkmale leisteten einen signifikanten Beitrag zur Erklärung dieser Unterschiede. Diskutiert wird, ob unterschiedliche kulturelle Leitbilder in der Mutterrolle von ost- und westdeutschen Müttern zu den Befunden beigetragen haben.
Schlüsselwörter: Gratifikationskrise,Tätigkeitsfeld Haushalt und Familie, Stress, Ost-West-Unterschiede, Mütter, Mediator-Effekt
Dr. Stefanie Sperlich
Medizinische Hochschule Hannover
Medizinische Soziologie OE 5420
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
E-Mail: sperlich.stefanie@mh-hannover.de
Gesünder nach der Kur? Analyse von GKV-Daten mit Vorher-Nachher-Vergleich für Teilnehmerinnen einer Mutter-Kind-Maßnahme und Mütter ohne Kurbewilligung
Jelena Jaunzeme, Friederike Otto, Siegfried Geyer
Kurzfassung
In diesem Beitrag wird über die erstmalige Untersuchung der Effektivität von Mutter-Kind-Maßnahmen auf Grundlage der Daten einer gesetzlichen Krankenkasse berichtet.
Die Untersuchung basiert auf den Routinedaten der AOK Niedersachsen aus den Jahren 2004-2010 von N=10.824 Frauen zwischen 18 und 60 Jahren, die in diesem Zeitraum an einer Mutter-Kind-Maßnahme teilgenommen haben, N=6.615 Frauen, deren Antrag auf eine Maßnahme abgelehnt wurde, und Frauen einer parallelisierten Kontrollgruppe mit gleichen Sozialstrukturmerkmalen (N=43.869).
Die Analyse der Krankenkassendaten von den Teilnehmerinnen einer Mutter-Kind-Maßnahme und Müttern ohne entsprechende Bewilligung zeigt ein mehrschichtiges Bild der Inanspruchnahme gesundheitlicher Leistungen. Für beide Gruppen lässt sich eine häufigere Inanspruchnahme der psychotherapeutischen Leistungen wie ein höherer Schmerzmittel- und Psychopharmakaverbrauch feststellen als in der parallelisierten Kontrollgruppe. Damit lassen sich die aus früheren Befragungsstudien bekannten Ergebnisse anhand von Sekundärdaten bestätigen, dass Mütter, die einen Antrag auf eine Mutter-Kind-Maßnahme stellen, eine gesundheitlich beeinträchtigte Personengruppe darstellen, insbesondere im Bereich der seelischen Gesundheit. Vorher-Nachher-Vergleiche zeigen, dass sich Unterschiede zwischen den Gruppen hinsichtlich der Psychotherapiebehandlungen und des Psychopharmakaverbrauchs ergeben.
Schlüsselwörter: Mutter-Kind-Maßnahme, GKV-Routinedaten, Kureffekte, Arzneimittelverbrauch, Psychotherapie
Jelena Jaunzeme
Medizinische Soziologie, OE 5420
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str.1
30625 Hannover
E-Mail: jaunzeme.jelena@mh-hannover.de
Friederike Otto
Medizinische Soziologie, OE 5420
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str.1
30625 Hannover
E-Mail: otto.friederike@mh-hannover.de
Prof. Dr. Siegfried Geyer
Medizinische Soziologie, OE 5420
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str.1
30625 Hannover
E-Mail: geyer.siegfried@mh-hannover.de
Nachsorge als Bestandteil der therapeutischen Kette im Rahmen von Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen nach §24 und §41 SGB V
Kati Mozygemba
Kurzfassung
Das Müttergenesungswerk zielt darauf ab, Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen für Mütter und Väter1, die nach §24 und §41 des SGB V durchgeführt werden, in die "therapeutische Kette" von Kurberatung, stationärer Maßnahme und Kurnachsorge zu einem Ganzen zu verbinden (MGW, 2013). Während Kurberatung und stationäre Maßnahme kooperativ ineinandergreifen, finden sich hinsichtlich der Nachsorge im Bereich der Müttergenesung vielfältige nicht standardisierte und wenig dokumentierte Angebote. Auch findet sich keine systematische Evaluation, die die angenommene und von Praktikerinnen sowie Nachsorgeteilnehmerinnen beschriebene Unterstützung durch Nachsorge empirisch belegen könnte. Diese Lücken wollten die Arbeiterwohlfahrt Ostwestfalen Lippe (OWL) und der GesundheitsService AWO schließen, indem seit 2008 in allen 21 AWO-Kliniken ein einheitliches Nachsorgeprogramm implementiert und in der Zeit von 2011 bis 2013 wissenschaftlich evaluiert wurde.
Grundlage der Evaluationsstudie bilden 733 Maßnahmeteilnehmerinnen aus sechs Kliniken in AWO-Trägerschaft, die über einen Zeitraum von 10 Monaten insgesamt fünfmal befragt wurden. Für die Auswertung wurden verschiedene Outcomeparameter von Nachsorgeteilnehmerinnen (Interventionsgruppe) und Nichtteilnehmerinnen (Kontrollgruppe) miteinander verglichen.
Insgesamt finden sich Hinweise darauf, dass die Ergebnisse den Ansatz der therapeutischen Kette, stationäre Maßnahme und Nachsorge zu integrieren, unterstützen. Sie legen nahe, wie groß der subjektiv eingeschätzte Bedarf und der Wunsch nach fachlicher Unterstützung bei der Zielumsetzung im Alltag bei den Patientinnen in einer Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahme nach §24 und §41 SGB V ist, worauf sich dieser Unterstützungsbedarf inhaltlich bezieht und liefern darüber hinaus einen Beitrag zu einer systematischen Erfassung von Nachsorgeangeboten im Bereich der Müttergenesung. Es wird deutlich, dass die strukturierte und standardisierte Nachsorge des GesundheitsService AWO Teilnehmerinnen bei der Umsetzung ihrer Gesundheitsziele im Alltag unterstützt, dass die Nachsorgeteilnehmerinnen diese Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ziele in den Alltag wahrnehmen und als hilfreich empfinden. Aber es wird auch deutlich, dass der subjektive Bedarf an fachlicher Unterstützung bei der Zielumsetzung nach der Maßnahme unter den Befragten zurzeit nicht ausreichend gedeckt scheint.
Schlüsselwörter: Nachsorge, therapeutische Kette, Mutter-Kind-Maßnahme, Gesundheitsziele im Alltag, Vorsorge und Rehabilitation
Dr. Kati Mozygemba
Institut für Public Health und Pflegeforschung
Universität Bremen
Grazer Straße 4
28359 Bremen
E-Mail: kati.mozygemba@uni-bremen.de
Mütter mit chronischen Rückenschmerzen: Nachhaltigkeit der Behandlung in Mutter-Kind-Kliniken
Dorothee Noeres, Friederike Otto
Kurzfassung
Dieser Beitrag untersucht, inwiefern Müttern mit Erziehungsverantwortung1 und Rückenschmerzen in Mutter-Kind-Kliniken geholfen werden kann, ihre Schmerzen kurzfristig und nachhaltig zu lindern. Dabei wird zwischen zwei Untersuchungsgruppen unterschieden: 1. Patientinnen, die in der Maßnahme schwerpunktmäßig auf Rückenschmerzen hin behandelt werden (SG), und 2. Personen, bei denen Rückenschmerzen als Komorbidität vorliegen (KG).
Die Auswertungen basieren auf einer an der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführten Studie zu Belastungen und Ressourcen von Müttern und Vätern in Erziehungsverantwortung (BelRes-Studie). 1323 teilnehmende Personen wurden vor und zu Beginn, am Ende und neun Monate nach Abschluss einer Mutter-Kind-Maßnahme befragt, darunter mit dem RSKF-20 (Schmidt, 2007), der Beschwerdenliste (von Zerssen, 1976) sowie Fragen zur psychischen Befindlichkeit (SCL-K-9, Klaghofer & Brähler, 2001). Die Nachhaltigkeit der gezielten Behandlung von Rückenschmerzen und Vergleiche zwischen den beiden Untersuchungsgruppen wurden mit non-parametrischen Tests berechnet. Chi-Quadrat-Tests dienten zur Ermittlung von möglichen Zusammenhängen zwischen der Inanspruchnahme von Hilfsangeboten nach der Mutter-Kind-Maßnahme sowie vorgenommenen Alltagsveränderungen einerseits und dem nachhaltigen Ausbleiben von Rückenschmerzen andererseits.
Zu Beginn der Maßnahme wiesen Patientinnen der SG stärkere somatische Beschwerden einschließlich Rückenschmerzen auf als Mütter der KG, die eine höhere psychische Gesamtbelastung hatten. Die Patientinnen mit Schwerpunktbehandlung Rückenschmerz zeigten zum Ende der Maßnahme höchst signifikante Veränderungen bezogen auf Schmerzschwere sowie emotionale und kognitive Schmerzverarbeitung. Für die Mehrzahl der Betroffenen blieben die positiven Effekte auch neun Monate nach Abschluss der Maßnahme erhalten. Eine Verbesserung ihrer Symptome bezogen auf Kreuz- oder Rückenschmerzen zeigten auch Patientinnen der KG. Ebenso zeigte sich der Maßnahmeerfolg für beide Untersuchungsgruppen dahingehend, dass die Mütter im Anschluss an die Maßnahme Veränderungen in ihrem Alltagsleben vornahmen. Zwischen diesen und dem Auftreten von Schmerzen wurden signifikante Zusammenhänge gemessen.
Weiterer Forschungsbedarf besteht hinsichtlich der Frage, wie die Behandlungseffekte für eine noch größere Zahl von Patientinnen verstetigt werden können.
Schlüsselwörter: Chronische Rückenschmerzen, Mutter-Kind-Maßnahmen, Nachhaltigkeit
Dorothee Noeres
Medizinische Hochschule Hannover
Medizinische Soziologie OE 5420
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
E-Mail: noeres.dorothee@mh-hannover.de
Friederike Otto
Medizinische Hochschule Hannover
Medizinische Soziologie OE 5420
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
E-Mail: otto.friederike@mh-hannover.de
Adipositasbehandlung und Sportverhalten nach einer Mutter-Kind-Maßnahme
Felix Barre, Friederike Otto
Kurzfassung
Die Aufrechterhaltung eines erfolgreich reduzierten Körpergewichtes stellt die größte Herausforderung in der Therapie der Adipositas dar. Neben einer kalorienreduzierten Ernährung ist körperliche Bewegung geeignet, eine Gewichtszunahme zu verhindern, wobei die Freude am Sport die Voraussetzung zu sein scheint, Sport langfristig zu betreiben (Wirth, 2008).
In diesem Beitrag wird untersucht, ob eine Mutter-Kind-Maßnahme eine nachhaltige Gewichtsreduktion bzw. -stabilisier
ng bei den Müttern einleiten kann und welchen Einfluss Bewegungsmotivation, Bewegungsverhalten, allgemeine Beschwerden und soziodemografische Merkmale auf den Reduktionserfolg ein Jahr nach der Maßnahme haben.
Die Evaluation wurde von Juni bis September 2008 in 15 Vorsorge- und Rehabilitationskliniken für Mütter und Kinder durchgeführt. Einschlusskriterien für die Studienteilnahme waren ein BMI ≥ 25 und der Wunsch nach Gewichtsreduktion. Das Studiendesign war eine prospektive Verlaufsstudie mit schriftlichen Befragungen zu Beginn (t1) und am Ende (t2) einer Mutter-Kind-Maßnahme sowie zwei Nachbefragungen nach 6 (t3) und 12 Monaten (t4). An der Erstbefragung nahmen 532 Mütter teil, an der Nachbefragung zu t4 beteiligten sich 222 Mütter (41,8%). Aspekte des Bewegungsverhaltens und der Gewichtsentwicklung wurden mit dem interdisziplinären Testverfahren AD-EVA (Ardelt-Gattinger & Meindl, 2010) erhoben. Allgemeine Beschwerden wurden mit der Beschwerdenliste B-L (von Zerssen, 1976) erfasst.
Von den Müttern, die an der Nachbefragung teilgenommen haben, konnten 162 (30,5% der Gesamtstichprobe) ihr Gewicht nach einem Jahr im Vergleich zum Zeitpunkt vor der Maßnahme halten bzw. reduzieren. Die Bewegungsmotivation konnte im Verlauf der stationären Maßnahme signifikant gesteigert werden. Bei Müttern, die im Jahr nach der Kur zunahmen, ging die Bewegungsmotivation auf das Ausgangsniveau zurück, während bei Müttern, die ihr Gewicht halten oder reduzieren konnten, die erhöhte Bewegungsmotivation erhalten blieb. Allerdings wiesen diese Patientinnen schon zu Beginn der Maßnahme eine höhere Bewegungsmotivation auf. Zwischen Bewegungsmotivation, Bewegungshäufigkeit und Reduktionserfolg zeigten sich geringe bis mittlere signifikante Korrelationen. Allgemeine Beschwerden und soziodemografische Merkmale beeinflussten weder die Bewegungsmotivation noch die Gewichtsreduktion.
Die Ergebnisse der Untersuchung belegen die Relevanz von Spaß und Freude an Bewegung und Sport für den Langzeiterfolg einer Adipositasbehandlung in Mutter-Kind-Einrichtungen. Daher kann die Förderung der Bewegungsmotivation für die Therapie empfohlen werden.
Schlüsselwörter: Übergewicht, Adipositas, Mutter-Kind-Maßnahme, Bewegungsmotivation, AD-EVA
Felix Barre
Medizinische Soziologie OE 5420
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str. 1
30625 Hannover
E-Mail: barre.felix@mh-hannover.de
Veränderung des Patientenprofils in Mutter-Kind-Kliniken 2000-2011
Friederike Otto
Kurzfassung
Hintergrund: Im vergangenen Jahrzehnt war familiales Leben einer Reihe neuer Anforderungen ausgesetzt. Dazu zählten Arbeitsplatzunsicherheit und drohende Armut, Instabilität und Vielfalt der Familienformen sowie steigende Erwartungen an die Erziehung und Bildung der Kinder. In diesem Beitrag wird untersucht, wie sich die psychosozialen Belastungen und die soziodemografischen Merkmale von Müttern, die an einer stationären Mutter-Kind-Maßnahme teilgenommen haben, seit dem Jahr 2000 verändert haben und inwiefern die Teilnehmerstruktur in diesem Zeitraum der Verteilung in der Allgemeinbevölkerung entsprach.
Methode: Grundlage der Untersuchung sind die soziodemografischen Daten und die Angaben der Patientinnen zu belastenden Kontextfaktoren, die nachweislich die Gesundheit beeinträchtigen können und bei der Bewilligung einer Mutter-Kind-Maßnahme zu berücksichtigen sind. Die Daten stammen aus sechs Evaluations- und Qualitätssicherungsprojekten aus den Jahren 2000 bis 2011, an denen 50 Mutter-Kind-Kliniken mit insgesamt n=10.008 Müttern teilnahmen. Die soziodemografischen Merkmale der Patientinnen werden mit Daten des bevölkerungsrepräsentativen Sozio-oekonomischen Panels (SOEP, Wagner et al., 2008) der jeweiligen Erhebungsjahrgänge verglichen.
Ergebnisse: Zwischen den Jahren 2000 und 2011 ist das Durchschnittsalter der Mütter, die an einer Mutter-Kind-Maßnahme teilnahmen, von 34 auf 38 Jahre gestiegen und der Anteil der Patientinnen mit höherer Bildung hat zugenommen. 81% der untersuchten Studienteilnehmerinnen waren im Jahr 2011 erwerbstätig gegenüber 49% im Jahr 2000. Während das Bildungsniveau der Teilnehmerinnen der untersuchten Mutter-Kind-Maßnahmen im Jahr 2000 dem von Müttern der Allgemeinbevölkerung entsprach, waren Patientinnen in Mutter-Kind-Maßnahmen mit geringer formaler Bildung in den Folgejahren zunehmend unterrepräsentiert. Im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung waren Alleinerziehende und Mütter mit drei und mehr Kindern zu allen Erhebungszeitpunkten überproportional häufig in Mutter-Kind-Maßnahmen vertreten. Die von den Müttern am häufigsten genannten Kontextfaktoren waren in allen Befragungen das ständige Dasein für die Familie, Belastungen durch den Haushalt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Erziehungs-, Partnerschafts- und finanzielle Probleme. In der Tendenz ist der Anteil der hochbelasteten Mütter unter den Kurteilnehmerinnen über die Jahre angestiegen.
Schlussfolgerung: Das veränderte Patientenprofil, insbesondere der hohe Anteil erwerbstätiger Mütter und die damit verbundene Vereinbarkeitsproblematik, stellt neue Anforderungen an die Mutter-Kind-Kliniken. Die Zugangswege für Mütter mit geringerer Bildung waren in den letzten Jahren offenbar erschwert. Die neue Begutachtungsrichtlinie für Vorsorge und Rehabilitation (MDS, 2012) sollte mit der stärkeren Gewichtung belastender Kontextfaktoren den Zugang für sozial benachteiligte Mütter erleichtern und dazu beitragen, die gesundheitliche Ungleichheit zu reduzieren.
Schlüsselwörter: Mutter-Kind-Maßnahmen, Vorsorge, Rehabilitation, psychosoziale Kontextfaktoren, SOEP, Patientenprofil
Friederike Otto
Medizinische Soziologie OE 5420
Medizinische Hochschule Hannover
Carl-Neuberg-Str. 1
30655 Hannover
E-Mail: otto.friederike@mh-hannover.de
"Man muss natürlich auch was dafür tun
" - Worauf kardiologische Rehabilitanden den Erfolg der Rehabilitationsmaßnahme zurückführen
Erika Schmidt, Antje Ullrich, Erik Farin, Manuela Glattacker
Kurzfassung
Ziele der Studie: Ziel der Studie war eine qualitative Untersuchung von Faktoren, auf die Rehabilitanden mit chronischer ischämischer Herzkrankheit den Erfolg ihrer Rehabilitation zurückführen.
Methodik: Es wurden leitfadengestützte Einzelinterviews zu sechs Reha-Zielbereichen durchgeführt: Körperliches Befinden, Seelisches Befinden, Zurechtkommen im Alltag, Zurechtkommen im Beruf, Kontakt zu anderen Menschen und Gesundheitszustand insgesamt. Es wurden elf Patienten mit der Diagnose chronische ischämische Herzkrankheit befragt, die im Mittel 63,0 Jahre (±12,0) alt waren.
Ergebnisse: Die Aussagen konnten 15 Attributionskategorien zugeordnet werden. Die meisten Kategorien wurden für Verbesserungen des körperlichen und seelischen Befindens genannt. Körperliche Erfolge wurden hauptsächlich auf Strukturen und Prozesse der Einrichtung attribuiert, seelische Erfolge meist auf die Krankheitsbewältigung.
Schlussfolgerung: Einige Attributionskategorien liefern potentielle Ansatzpunkte für Behandler, um auf Erfolgswahrnehmungen der Rehabilitanden einzuwirken.
Schlüsselwörter: Subjektiver Rehabilitationserfolg, Kausalattribution, Erfolgsattribution, chronische ischämische Herzkrankheit, qualitatives Interview
Erika Schmidt
Antje Ullrich
Erik Farin
Manuela Glattacker
UNIVERSITÄTSKLINIKUM FREIBURG
Institut für Qualitätsmanagement und Sozialmedizin
Engelbergerstraße 21
79106 Freiburg im Breisgau
E-Mail: erika.schmidt@uniklinik-freiburg.de