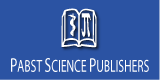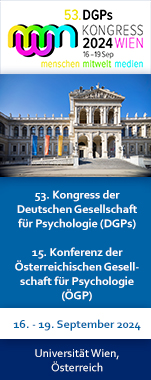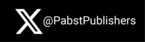Der Ehemann ist an Krebs gestorben, die Tochter bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Für die Ehefrau im einen, für die Eltern im anderen Fall ist eine Welt zusammengebrochen. Und immer haben die Betroffenen zunächst das Gefühl, dass kein Stein mehr auf dem anderen steht. Wie geht es Menschen nach solch einem Schicksalsschlag? Wie bewältigen sie diesen Verlust, wie verläuft ihre Trauer? Und wie lange dauert es, bis das Schlimmste überwunden ist? Psychologen der Universität Würzburg haben diese Fragen untersucht; in der aktuellen Ausgaben der Zeitschrift für Gesundheitspsychologie stellen sie ihre Ergebnisse vor.
Mehr als 500 Personen, die meisten von ihnen verwitwet oder verwaiste Eltern, haben für diese Studie ihr Erleben nach dem Verlust anhand eines neuen Fragebogens beschrieben. So konnten die Wissenschaftler verschiedene Aspekte des Trauerns messen. "Wir haben uns dabei besonders für den Einfluss der Zeit seit dem Verlust, also für die Dauer des Trauerprozesses interessiert", erklärt Joachim Wittkowski, Seniorprofessor an der Fakultät für Humanwissenschaften der Universität Würzburg. Er hat gemeinsam mit Dr. Rainer Scheuchenpflug, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Psychologie III, die Untersuchung durchgeführt.
Deutliche Veränderungen in den ersten Jahren
Fasst man die Antworten von Personen zusammen, deren Verlust eine ähnlich lange Zeit zurückliegt, so zeigen sich vor allem während der ersten zweieinhalb Jahre nach dem Todesfall deutliche Veränderungen. "Innerhalb des ersten Jahres nehmen Beeinträchtigungen durch unangenehme Gedanken und Gefühle einerseits und das Empfinden der Nähe zu der verstorbenen Person andererseits an Intensität stark zu", schildert Joachim Wittkowski ein zentrales Ergebnis der Studie. Ähnlich stark verlaufe dann die Abnahme dieser Intensität während der folgenden zwölf bis 18 Monate. Dabei leiden Frauen stärker unter dem Verlust einer nahen Bezugsperson als Männer.
Ein weiteres Ergebnis: Auf längere Sicht, das heißt, über den Zeitraum von drei Jahren hinaus, lassen sowohl die Beeinträchtigungen als auch das Empfinden der Nähe zur verstorbenen Person beständig nach. "Interessant ist, dass am Ende der heißen Phase des Trauerns sowohl positive Erlebens- und Verhaltensmöglichkeiten zunehmen als auch die Fähigkeit zu Anteilnahme und Mitgefühl mit anderen Menschen wächst", sagt Wittkowski. Dieser Trend bleibe auch mehr als zehn Jahre nach dem Verlust erhalten. Schuldgefühle blieben langfristig nahezu unverändert auf einem mittleren Intensitätsniveau.
Die Bewältigung des Verlusts zieht persönliches Wachstum nach sich
Aus Sicht der Wissenschaftler berichtigen diese Ergebnisse, die für Personen aus dem deutschsprachigen Raum bisher einmalig sind, einige gängige Vorstellungen vom Trauern. "Neben Kummer ist Trauern auch mit persönlichem Wachstum verbunden, das von den Betroffenen rückblickend positiv erlebt wird", erklärt Joachim Wittkowski. Die Bewältigung des Verlusts eines geliebten Menschen könne also zu einer vorteilhaften Veränderung des Betroffenen führen. "Die Zeit bringt den Schmerz des Trauerns nicht zum Verschwinden, sie vermag ihn aber zu lindern", so der Autor.
Trauern ist ein Prozess, der sich lange hinzieht - auch das zeigt die Studie. Für viele Betroffene ist er nicht nach wenigen Monaten und nicht einmal nach dem traditionellen Trauerjahr abgeschlossen. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich erst im zweiten Jahr nach dem Verlust entscheidet, ob die Beeinträchtigungen abnehmen oder auf hohem Niveau bestehen bleiben, ob also ein normaler Bewältigungsprozess oder ein behandlungsbedürftiges Trauern vorliegt", so die Wissenschaftler. Für die Diagnose einer anhaltenden komplexen Trauerreaktion sei dies von eminenter Bedeutung.