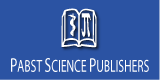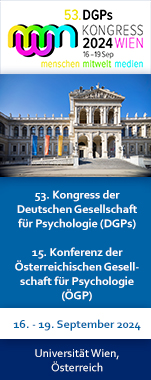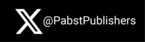Hirnregionen lassen sich gezielt trainieren: Videospielen vergrößert Hirnbereiche, die für räumliche Orientierung, Gedächtnisbildung, strategisches Denken sowie Feinmotorik bedeutsam sind. Das zeigt eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus. Die positiven Effekte von Videospielen könnten auch bei der Therapie psychischer Störungen zum Tragen kommen.
Um herauszufinden, wie sich Videospielen auf das Gehirn auswirkt, ließen die Wissenschaftler aus Berlin Erwachsene über zwei Monate hinweg täglich 30 Minuten das Videospiel "Super Mario 64" spielen. Eine Kontrollgruppe durfte nicht spielen. Mit Hilfe der Magnetresonanztomographie (MRT) wurde die Struktur des Gehirns vermessen. Im Vergleich zur Kontrollgruppe zeigte sich bei den Videospielprobanden eine Vergrößerung einiger Bereiche der grauen Substanz, in der sich die Zellkörper der Nervenzellen des Gehirns befinden. Die Vergrößerung umfasste den rechten Hippokampus, den präfrontalen Kortex und Teile des Kleinhirns. Diese Hirnareale sind unter anderem für räumliche Orientierung, Gedächtnisbildung, strategisches Denken sowie für die Feinmotorik der Hände von zentraler Bedeutung. Interessanterweise waren diese Veränderungen umso ausgeprägter, je mehr Spaß die Probanden beim Spielen hatten.
"Während vorhergehende Studien veränderte Hirnstrukturen bei Videospielern lediglich vermuten konnten, können wir mit dieser Studie einen direkten Zusammenhang zwischen dem Spielen und einem Volumenzuwachs nachweisen. Das belegt, dass sich bestimmte Hirnregionen durch Videospielen gezielt trainieren lassen", sagt Studienleiterin Simone Kühn, Wissenschaftlerin am Forschungsbereich Entwicklungspsychologie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung. Deshalb vermuten die Forscher, dass sich Videospiele für die Therapie von Erkrankungen eignen könnten, bei denen die entsprechenden Hirnregionen verändert sind. Das ist zum Beispiel bei psychischen Störungen wie der Schizophrenie, der posttraumatischen Belastungsstörung oder neurodegenerativen Erkrankungen wie der Alzheimer-Demenz der Fall.
"Viele Patienten werden Videospiele eher akzeptieren als andere medizinische Interventionen", ergänzt Co-Autor der Studie und Psychiater Jürgen Gallinat von der Psychiatrischen Universitätsklinik der Charité im St. Hedwig-Krankenhaus. Deshalb möchten die Forscher in weiteren Studien die Wirkung von Videospielen bei Menschen mit psychischen Störungen genauer untersuchen. Derzeit wird dies in einer Studie zur Posttraumatischen Belastungsstörung praktisch umgesetzt.