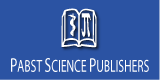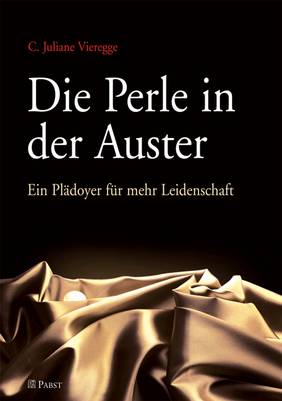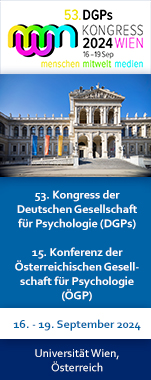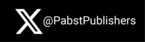Man muss es ja nicht so bunt treiben wie Abdelaziz ibn Saud. Dem 1953 verstorbenen Gründer des modernen Königreichs Saudiarabien wird nachgesagt, er habe 50 bis 60 Kinder von 17 Ehefrauen gehabt. Der amtierende südafrikanische Präsident Jacob Zuma ist derzeit mit immerhin drei Frauen verheiratet.
Was den Europäer irritieren mag, war in der Geschichte der Menschheit der Normalfall: In 85 Prozent der menschlichen Gesellschaften, die von Anthropologen je beschrieben wurden, war es Männern erlaubt, mehr als eine Frau zu heiraten. «Nicht die Polygamie, sondern die Monogamie ist eine seltsame Sache», sagt der Psychologe Joseph Henrich von der University of British Columbia. Jetzt glaubt er, das Rätsel der Monogamie gelöst zu haben. Die Einehe habe sich in der Welt grösstenteils durchgesetzt, weil sie unter den Männern die Konkurrenz um die Frauen vermindere und deshalb Gesellschaften friedlicher und produktiver mache («Philosophical Transactions of the Royal Society B», Bd. 367, S. 657).
Evolutionspsychologen, Anthropo logen und Historiker sind sich einig: In einer Gesellschaft, in der Besitz ungleich verteilt ist und vor allem die Männer die Ressourcen kontrollieren, ist Polygamie die beste Heiratsstrategie, nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. «Wenn die Männer unterschiedlich reich sind, dann ist es für eine Frau attraktiv, die zweite Gattin eines reichen Mannes zu werden», erklärt Henrich. «Sind aber alle Männer gleichgestellt, gibt es für eine Frau kaum einen Grund, die Nummer zwei zu werden.»
Kulturelle Evolution
Den positiven Seiten der Polygamie zum Trotz: Heute hat sich die Monogamie als Heiratsform besonders in den industrialisierten Ländern durchgesetzt. Als Erste propagierten die Griechen und die Römer in Europa die monogame Ehe. «Global hat sich dieses Heiratssystem aber erst in den letzten Jahrhunderten ausgebreitet», erklärt Henrich. Gesetze, die die Polygamie verbieten, existieren in Japan seit 1880, in China seit 1953 und in Nepal gerade einmal seit 1963.
Was ist der Schlüssel zum Erfolg der Monogamie? Glaubt man Henrich, hat sich diese Heiratsform in einem Prozess der «kulturellen Evolution» behauptet: Gesellschaften, welche die Monogamie praktizierten und diese in Normen oder Gesetzen verankerten, hatten einen Vorteil gegenüber solchen, die das nicht taten. Ehelicht ein Mann mehrere Frauen, dann kommen zwangsläufig nicht alle Herren der Schöpfung zu einer Partnerin. Die Monogamie hingegen verkleinert den Pool unverheirateter und deshalb frustrierter Männer.
«Monogamie reduziert die Kriminalitätsraten - bei Vergewaltigungen, Mord, Körperverletzungen und Raubüberfällen», sagt Joseph Henrich. Dabei stützt er sich unter anderem auf Erkenntnisse aus dem China und dem Indien der Moderne. In diesen Ländern führte die staatliche Bevölkerungspolitik beziehungsweise die Geschlechtspräferenz vieler Eltern dazu, dass Männer gegenüber Frauen zahlenmässig überhandnehmen. «Überall zeigt sich dasselbe Muster», erklärt Henrich: «Unverheiratete Männer mit einem niedrigen sozialen Status verhalten sich aggressiver und gewalttätiger.»
Heirats-Konkurrenz unter Männern verstärkt zudem die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, weil die Männer versuchen, die rarer werdenden Frauen wie Trophäen zu hüten und zu kontrollieren. Wer aber wie bei der Monogamie weniger Energie und Ressourcen in die Suche nach einer Frau stecken muss, der kann später mehr in die Ausbildung seiner Kinder investieren und verbessert damit die Produktivität der ganzen Gesellschaft.
Ein Vorteil vor allem nach 1945
Monogamie wirkt sich nicht zuletzt auf die Verwandtschaft aus. In monogamen Familien sind die einzelnen Mitglieder näher miteinander verwandt. «Und unter Verwandten ist das Risiko eines Kindsmissbrauchs geringer», sagt Henrich. Eine Studie in den USA ergab, dass Stiefmütter ihre Stiefkinder 2,4-mal häufiger umbringen als leibliche Mütter ihre eigenen Kinder («Violence and Victims», Bd. 19, S. 75).
«Ich bezweifle nicht, dass die Monogamie Verbrechen, aber auch Konflikte innerhalb der Familie reduziert», sagt Walter Scheidel von der Stanford University, der an Henrichs Studie nicht beteiligt war. «Ich bin mir aber nicht sicher, ob das für den grössten Teil der Menschheitsgeschichte der Fall war.» Polygamie sei, so der aus Österreich stammende Historiker, vermutlich vor allem in modernen, friedlichen und klar abgegrenzten Gesellschaften - wie in der Periode nach 1945 - ein Nachteil gewesen. «In solchen Gesellschaften konnte der aufgestaute Frust der Männer ohne Frauen nicht mehr in kriegerische Aktivitäten umgelenkt werden.
Nicht zu unterschätzen sei auch der Einfluss des Christentums. Es habe entscheidend dazu beigetragen, die Monogamie in der Zeit nach den Römern zu normieren und zu konservieren. «Zudem waren die Europäer bereits monogam, als sie andere Gesellschaften kolonisierten und begannen, die Welt zu dominieren», erklärt Scheidel. Viele Kolonien hätten die Monogamie von den Europäern als eher oberflächlichen Brauch übernommen.
Heute wird Polygamie vor allem noch im tropischen Afrika, im Mittleren Osten und in Teilen Asiens praktiziert. Geht Henrichs These der kulturellen Evolution sowie des Effekts der Modernisierung auf, so müsste sich die Vielweiberei auch dort eines Tages überleben. Aber vielleicht gibt es bis dann schon wieder ganz neue Formen der Polygamie. Derzeit breitet sich in der westlichen Welt die «Polyamorie» aus. Ihre Anhänger propagieren Liebesbeziehungen zu mehr als einem Menschen - im Wissen und Einverständnis aller Beteiligten.
Literatur zum Thema:
Die Perle in der Auster
Ein Plädoyer für mehr Leidenschaft
Vieregge, C. Juliane