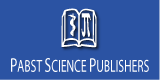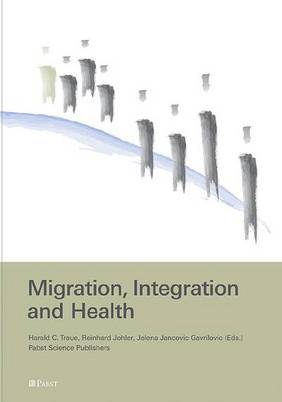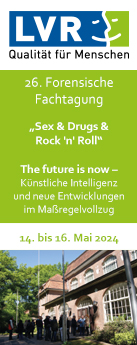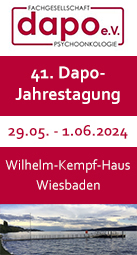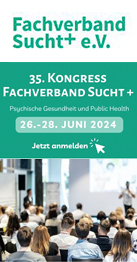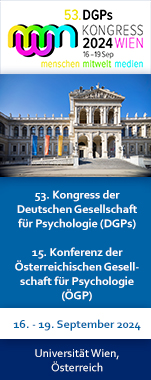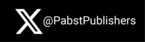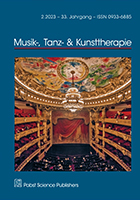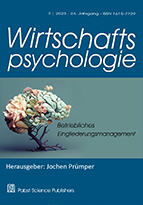"Der enge Zusammenhang zwischen einer gescheiterten partnerschaftlichen Beziehung und einer posttraumatischen Belastungsstörung kann mit der hohen Wertigkeit der Ehe in bestimmten Kulturen und besonders im Kontext der Heiratsmigration erklärt werden," erläuterte Privatdozentin Dr. Yesim Erim vor dem Psychosomatik-Kongress in Essen.
Diesen Frauen sei deshalb nicht mit dem Rat geholfen, sich vom Ehemann loszusagen und ein eigenes Leben anzufangen. "Das würde verkennen, dass es für türkischstämmige Frauen meist kein Rollenmuster zur Gestaltung des sozialen Lebens nach einer Trennung oder Scheidung gibt", so die Ärztin und Psychotherapeutin. Dies ändere sich jedoch zunehmend. "Auch suchen türkische Männer erstmals nach psychotherapeutischen Behandlungsmöglichkeiten. Alleine zu wohnen und alleinerziehend zu sein, bereiten ihnen Probleme", schildert Erim ihre Erfahrungen aus der interkulturellen Ambulanz an der Universitätsklinik Essen.
Bislang finden Migranten in Deutschland in erster Linie deutschsprachige Psychotherapeuten vor. "Das ist insofern problematisch, als zahlreiche psychische Belastungen nur vor dem Hintergrund ihres kulturellen Kontextes verstehbar werden", sagte Erim. Auch die muttersprachliche Behandlung sei hilfreich, denn Patienten nehmen eine Therapie dann eher in Anspruch; der Therapeut könne zudem sicherer beurteilen, ob eine psychische Störung vorliegt. Nach Ansicht der Wissenschaftlerin bestimmen Normen und Erwartungen einer Kultur unseren Gefühlshaushalt viel stärker als bisher angenommen.
 www.deutscher-psychosomatik-kongress.de
www.deutscher-psychosomatik-kongress.de
 www.deutscher-psychosomatik-kongress.de
www.deutscher-psychosomatik-kongress.de