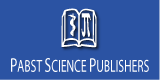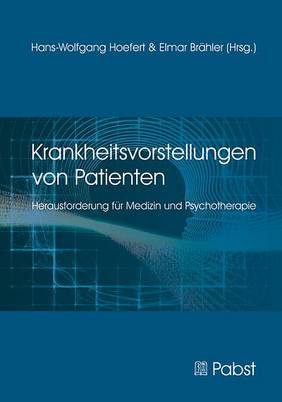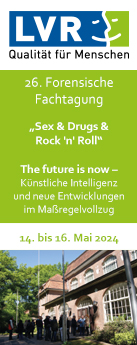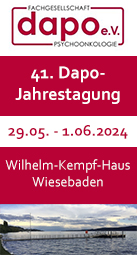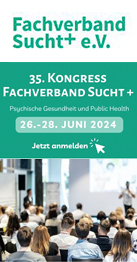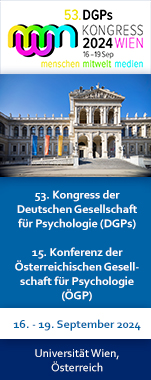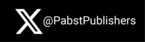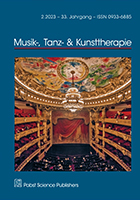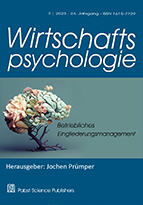Starke Ohrgeräusche - Tinnitus - können in Fällen starker psychosozialer Belastung oder psychischer und somatischer Erkrankung zu einem "Kondensationskern" der Gesamtbelastung werden, stellen Professor Dr. Jörg Frommer, Dr. Evelin Ackermann und Dr. Michael Langenbach in ihrer qualitativen Studie "Sinnkonstituierungsprozesse bei Tinnitus" fest. Mehr als eine Million Deutsche leiden an einem manifesten Tinnnitus. Eine Sinnkonstituierung kann den Leidensdruck annähernd erträglich machen.
Der Beitrag, veröffentlicht in dem aktuellen Reader "Krankheitsvorstellungen von Patienten", geht der Frage nach, wie Betroffene ihre Krankheit in die innere und äußere Lebensgeschichte einbetten.
"Viele Patienten bemühen sich, das Ohrgeräusch in ihre Selbstwahrnehmung als Subjekt zu integrieren. So wird das ´Defizit´, das durch das Dauergeräusch auf einem Ohr empfunden wird, durch eine gezielte Aufmerksamkeitsausrichtung auf das nicht betroffene Ohr oder durch eine Reduktion der eigenen Ansprüche kompensiert. Einzelne Patienten definieren ihre Tinnituswahrnehmung als intentionalen Akt, den sie willentlich beeinflussen können. Manche Patienten machen dies an einem Affektsteuerungsvermögen fest.
Im Gegensatz zu dieser Gruppe erleichtern sich andere Tinnituspatienten die Akzeptanz ihrer Beschwerden gerade durch die Berufung auf die eigene Ohnmacht. Sie geben an, dass sie keine andere Wahl hätten, als sich mit ihrem Leiden abzufinden. Die ohnmächtige Auslieferung an die übermächtige Beschwerde entspricht der Empfindung der demütigen Hinnahme des Unvermeidlichen, die den Patienten aushaltbar erscheint.
Eine weiter Möglichkeit der Herunterstufung der Beschwerden entsteht durch die Kontrastierung des gegenwärtigen Zustands mit einer evtl. zu erwartenden, aber noch in der Zukunft liegenden Verschlimmerung ..."
Der Reader "Krankheitsvorstellungen von Patienten" berichtet zu den wichtigsten Krankheitsbildern, mit welchen Philosophien oder Illusionen Betroffene versuchen, ihr Leiden in ihr Leben zu integrieren. Die Krankheitsvorstellungen können therapeutisch wirksam sein - positiv oder auch negativ - und sind daher für die Behandlung immer relevant.
Krankheitsvorstellungen von Patienten
Herausforderung für Medizin und Psychotherapie
Hoefert, Hans-Wolfgang; Brähler, Elmar (Hrsg.)