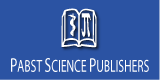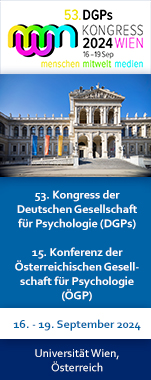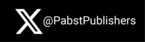Lebendspende für Nierentransplantation: Spender und Empfänger sind sehr unterschiedlich. Spender, zu zwei Dritteln Frauen, entscheiden sich meist spontan, eindeutig, klar. Empfänger, zu zwei Dritteln Männer, zögern meist, empfinden die Entscheidung vielschichtig, teils ambivalent. Über die auffälligen Tendenzen berichteten Dr. Denise Michalke und Professor Dr. Fritz Muthny (+) in "Praxis - Klinische Verhaltensmedizin und Rehabilitation".
Die Medizinpsychologen hatten Lebendspender und Empfänger im Nierentransplantationszentrum Münster (Westf.) untersucht. Je knapp 40 Prozent der Spender waren Ehepartner oder Eltern der Patienten, gut 20 Prozent Geschwister. "Am häufigsten erfolgte der Anstoß, die Lebendspende in Betracht zu ziehen, von Seiten des Spenders, gefolgt durch Äußerungen von ärztlicher Seite."
Die Psychologen stellten fest, "dass die Gruppe der Empfänger in stärkerem Maße eine allgemeine Ängstlichkeit im Hinblick auf die Transplantation zeigte sowie eine deutlich stärkere Sorge um den Spender als der Spender um den Empfänger. Auch war die Angst vor einer Abstoßung bei den Empfängern stärker ausgeprägt als bei den Spendern. Die Angst vor dem operativen Eingriff mit Narkose war in beiden Gruppen gleich."
Die Erwartungen an das Transplantationsergebnis sind unterschiedlich gewichtet: "Am häufigsten nannten die Spender - in dieser Rangreihenfolge - die Hoffnung auf Zunahme an Lebensqualität und körperliche Leistungsfähigkeit für den Empfänger, das Erlangen eines normalen Lebens sowie mehr Unabhängigkeit im Alltag." Für die Empfänger steht die Unabhängigkeit an erster Stelle, gefolgt von körperlicher Leistungsfähigkeit, einer Steigerung der eigenen Lebensqualität, Wegfall der Dialyse und Normalisierung des Alltags.
zum Journal