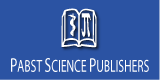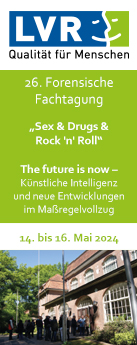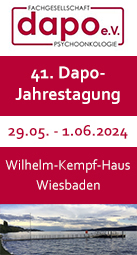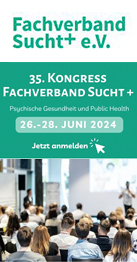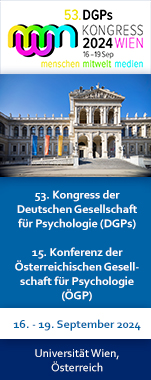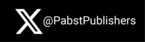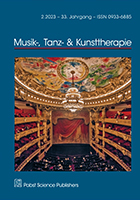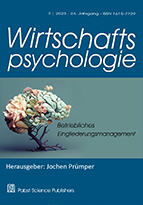Die Grundfunktionen des Menschen verstehen und erklären
„Experimente sind elementar für die psychologische Grundlagenforschung“, sagt Prof. Dr. Klaus Rothermund von der Universität Jena, einer der Organisatoren der Tagung. „Wir versuchen, die Grundfunktionen des Menschen zu verstehen und zu erklären, indem wir innerhalb von Versuchen unterschiedliche Bedingungen herstellen und überprüfen, welche Konsequenzen das auf das menschliche Handeln hat. Da wir während der Experimente manipulativ eingreifen, können wir sicher sein, dass wir Grundlegendes im menschlichen Verhalten kausal erklären und es nicht durch bestimmte Vorbedingungen beeinflusst ist.“ Die Allgemeine Psychologie – also etwa die Gedächtnis-, Emotions-, Motivations-, Aufmerksamkeits-, Wahrnehmungs- und Lernforschung – wäre ohne solche Versuche nicht möglich. Einen entsprechend fundamentalen Stellenwert nimmt die Experimentelle Psychologie auch an der Universität Jena ein.
Werkzeugkasten der Psychologie
Häufig greifen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei auf einen „Werkzeugkasten“ zurück. In diesem befinden sich bereits zuvor entworfene Musterversuchsanordnungen – sogenannte Paradigmen –, die für das jeweilige Experiment entsprechend angepasst, kombiniert und innovativ weiterentwickelt werden.
Auch während der Tagung tauschen sich die Teilnehmer über ihre Vorgehensweise und die Auswertung von Versuchsdaten mit digitalen Möglichkeiten aus. Im Mittelpunkt stehen aber vor allem Forschungsergebnisse – beispielsweise im Bereich des Spracherwerbs. So stellt Gabriella Vigliocco vom University College London in ihrem Vortrag neue Erkenntnisse vor, wie Kinder nicht nur Sprechen lernen durch das Hören und Anwenden von Gesagtem, sondern auch durch weitere Hinweise, die der Sprecher ihnen gibt. Dabei berichtet sie über neue Forschungsmethoden, die ihr erlauben, ihre Probanden in lebensnahen Umgebungen zu untersuchen.
Kontrollprozesse halten uns in der Spur
Ihre Londoner Kollegin Antonia Hamilton widmet sich in ihrer Key-Note den sozial-kognitiven und neuronalen Prozessen, die während der nonverbalen Kommunikation und Interaktion zwischen Menschen ablaufen. Im Besonderen hat sie untersucht, warum Menschen ihr Gegenüber imitieren, um sich mit ihm verbunden zu fühlen.
Tobias Enger von der Duke University im US-amerikanischen Durham präsentiert in seinem Vortrag neue Antworten auf die Frage, wie es dem Gehirn durch kognitive Kontrollprozesse gelingt, uns in der Spur zu halten. Kognitive Kontrolle ist insbesondere dann erforderlich, wenn Dinge passieren, die vom Gewohnten abweichen – wenn also beispielsweise der Fahrer in einem Fahrzeug von seinem routinierten Verhalten auf dem Weg zur Arbeit abweichen muss, weil sich plötzlich eine Gefahrensituation im Straßenverkehr eröffnet hat, die Aufmerksamkeit erfordert und die ein Ausbrechen aus bisherigen Handlungsroutinen erfordert.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof. Dr. Klaus Rothermund
Institut für Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Am Steiger 3, Haus 1
07743 Jena
E-Mail: klaus.rothermund[at]uni-jena.de
Quelle:
https://idw-online.de/de/news742794
Verfügbar:
Christian Dobel, Carina Giesen, Laura Anne Grigutsch, Jürgen M. Kaufmann, Gyula Kovács, Franziska Meissner, Klaus Rothermund, Stefan R. Schweinberger (Eds.):
62. TeaP 2020: Abstracts of the 62th Conference of Experimental Psychologists
Pabst 2020, 316 pages, Print ISBN 978-3-95853-593-0, eBook ISBN 978-3-95853-594-7
» zum Buch
Christiane Lange-Küttner (Ed.):
61. TeaP 2019: Abstracts of the 61st Conference of Experimental Psychologists
Pabst 2020, 316 pages, Print ISBN 978-3-95853-585-5, eBook ISBN 978-3-95853-586-2
» zum Buch