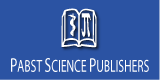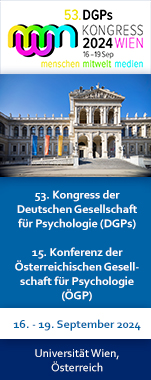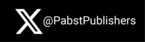Kinder sind egozentrischer als Erwachsene. Wissenschaftler vom Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften haben nun erstmals nachgewiesen, dass sie sich auch emotional schlechter in den Standpunkt eines anderen Menschen hineinversetzen können. Den Forschern zufolge muss bei Kindern zunächst der Supramarginale Gyrus der rechten Gehirnhälfte genügend entwickelt sein, damit sie egozentrisches Verhalten ablegen.
Wenn der kleine Philipp jubelt, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen hat, dann ist es ihm fast unmöglich zu erfassen, dass sein bester Freund Tom, der gerade verloren hat, nicht so fröhlich ist. Umgekehrt gilt das genauso. "Kinder sind einfach egozentrischer", fasst Nikolaus Steinbeis, Forscher am Leipziger Max-Planck-Institut, eine allgemeine Hypothese zusammen.
Als egozentrisch bezeichnet man die Unfähigkeit, den eigenen Standpunkt von dem eines anderen Menschen zu unterscheiden. Die eigene Person wird dabei als Zentrum allen Geschehens betrachtet und sämtliche Ereignisse werden hiervon ausgehend bewertet. Egozentrische Personen projizieren eigene Vorstellungen, Ängste und Wünsche in die Umwelt und eben auch auf andere Personen.
Bislang gibt es nur theoretische Überlegungen zu diesem Phänomen sowie Untersuchungen zur Entwicklung der kognitiven Perspektivübernahme. Die Frage nach dem Egozentrismus in Bezug auf emotionale Zustände des Menschen und dem Entwicklungsverlauf in der Kindheit ist von der Wissenschaft bisher weitgehend außer Acht gelassen worden. "So weiß man im Moment nur sehr wenig darüber, wie sich emotionale Egozentrik in der Kindheit ausdrückt und auf welchen neuronalen und kognitiven Prozessen sie beruht", erklärt Steinbeis.
Um die emotionalen Zustände unterschiedlicher Altersgruppen miteinander vergleichen zu können, hat Steinbeis ein neuartiges Spiel mit monetärer Belohnung und Bestrafung eingesetzt. "Frühere Studien hatten gezeigt, dass mit solchen Belohnungen und Bestrafungen bei Kindern wie Erwachsenen ähnlich starke emotionale Zustände provoziert werden können. Kinder freuen sich genauso wie Erwachsene über eine Geldbelohnung und ärgern sich ebenso stark bei Verlusten", sagt er.
Bei dem Spiel traten immer zwei Personen gegeneinander an, ohne dass sie sich sehen konnten. Ausgerüstet mit Bildschirm und Tastatur sollten die Probanden nun ihre Reaktionsgeschwindigkeit beweisen. Per Bildschirm erfuhren die Teilnehmer, ob sie oder der andere sich über einen Gewinn freuen oder über einen Verlust ärgern durften. Anschließend bestand ihre Aufgabe darin, die Emotionen des anderen einzuschätzen. Interessant war hier, wie stark das eigene Ergebnis die Einschätzung des Zustands des Anderen beeinflusste. Wenn ein Teilnehmer beispielsweise den anderen fröhlicher einschätzte, obwohl dieser gerade verloren hatte, weil er selber Gewinner war, war das ein Indiz für die egozentrische Projektion des eigenen Zustands.
Die Ergebnisse zeigen, dass Erwachsene mühelos diese Tendenz überwinden konnten, während die Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren dazu neigten, die eigene Emotion als Maßstab für den anderen heranzuziehen. Die Fähigkeit, die Emotionen des Gegenübers unabhängiger von der eigenen emotionalen Lage einzuschätzen, nimmt dabei mit dem Alter zu. "Je älter ein Kind ist, desto besser kann es sich in der Regel in die Gefühlswelt eines anderen Menschen hineinversetzen", erklärt Steinbeis die Ergebnisse.
Darüber hinaus haben die Wissenschaftler die Aktivität verschiedener Gehirnregionen im Kernspintomografen gemessen und dabei eine Region entdeckt, die für die Überwindung eigener Gefühle von entscheidender Bedeutung ist. Der sogenannte rechte Supramarginale Gyrus ist eine Region des temporoparietalen Kreuzungsareals, die allgemein für die Überwindung der eigenen Perspektive notwendig ist. Er ist stark mit Hirnregionen wie der anterioren Insel verbunden, die ausschließlich dafür zuständig ist, sich in Gefühlszustände andere Menschen hineinzuversetzen. "Das bedeutet, dass wir mit dem rechten Supramarginalen Gyrus eine Region gefunden haben, die vor allem der Überwindung der eigenen Gefühle dient", sagt Steinbeis. Außerdem stellten die Wissenschaftler fest, dass mit zunehmendem Alter die kortikale Dicke der Nervenfasern in diesem Bereich abnimmt. Dies deutet darauf hin, dass die Nervenfasern stärker aktiv sind.
Bei vielen Konflikten spielt emotionale Egozentrik eine große Rolle, denn die Unfähigkeit, egozentrisches Denken zu überwinden, führt zu unangepasstem Sozialverhalten. Die Betroffenen werden entsprechend zurückgewiesen, was nachweislich Gesundheit und Entwicklung beeinträchtigt. Wissenschaftler wollen deshalb die Gründe für nachteiliges soziales Verhalten verstehen und Interventionsmöglichkeiten entwickeln.