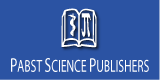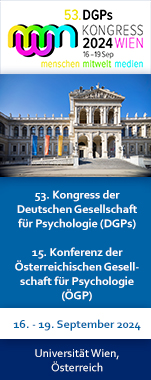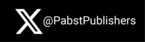An einem hellen Tag im Spätsommer ist Matthias Heißler wieder einmal unterwegs und fährt über die Dörfer Schleswig-Holsteins, hinaus zu seinen Patienten. Er ist Chefarzt der Psychiatrischen Abteilung im Johanniter-Krankenhaus in Geesthacht. Doch anstatt im weißen Kittel über die Flure seiner Station zu laufen, ist er oft unterwegs, in Jeans und Sakko. Im vergangenen Jahr hat er rund 40.000 Kilometer zurückgelegt. Denn die meisten seiner Patienten betreut er daheim, in ihren Wohnungen, in ihrem Umfeld, in den Dörfer und Städten des Herzogtum Lauenburgs.
Heißler, 60, ist bei einer Patientin angekommen und klingelt im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses. Dort wohnt Frau H., die seit Wochen unter einer schweren Depression leidet. Heißler betritt ihre Wohnung, an den Regalen hängt Wäsche zum Trocknen. Frau H. sitzt auf einem Bett, das im Wohnzimmer steht, daneben ihre Tochter, sie trägt einen Schnuller und schaut gerade einen Zeichentrickfilm.
Heißler setzt sich ihr gegenüber aufs Sofa und beginnt, sich mit Frau H. zu unterhalten. Ob sie zuletzt arbeiten war? Wie gut das Verhältnis zum Vater ihrer Tochter sei? Ob er mal mitkommen soll, wenn sie ihre Eltern besucht? Er fragt nach den Tabletten, die Frau H. zurzeit nimmt, fragt nach Wirkstoffen und Milligrammstärken, fragt, was sie sich von diesen Tabletten erhofft.
Die junge Mutter sitzt da mit verschränkten Armen und ringt mit den Tränen. "Die Tabletten sollen machen, dass ich so leben kann wie früher." Heißler nickt. Gibt es jemanden, der sie tröstet, wenn sie besonders traurig ist? Die Tochter reckt den Arm, rückt zu ihrer Mutter und umarmt sie.
"Wenn es schlimmer wird, könnten wir ihnen über die Krankenkasse auch eine Haushaltshilfe organisieren", rät Heißler. Nach einer halben Stunde verabschiedet er sich. In einigen Tagen wird er wiederkommen.
Ein unspektakulärer Patientenbesuch? Nein - eine kleine Revolution im deutschen Gesundheitswesen. Denn Heißler hat mit den Krankenkassen des Landkreises Herzogtum-Lauenburg einen Deal gemacht: Er bekommt das gleiche Budget für die Versorgung der Psychiatrie-Patienten wie früher, darf das Geld aber selbständig verwalten. Es ist eines der ganz wenigen Projekte dieser Art in Deutschland.
Damals wie heute erhält das Johanniter-Krankenhaus von den Krankenkassen sieben Millionen Euro pro Jahr für die Versorgung der psychiatrischen Patienten im Landkreis. Doch damals unterhielt Heißler 51 Psychiatriebetten auf drei Stationen - übrig geblieben ist davon nur noch eine Station mit 18 Betten. Vom eingesparten Geld hat er vier mobile Teams aufgebaut, die aus Ärzten, Pflegern, Psychologen und Sozialarbeitern bestehen und jeden Patienten bis zu zweimal täglich besuchen. Dieses "Home-Treatment" gilt heute als Goldstandard für die Behandlung von Psychiatrie-Patienten.
Doch in Deutschland werden immer mehr Patienten mit Depressionen, Schizophrenien oder Psychosen auf psychiatrische Stationen eingewiesen.
2013 wurden auf den psychiatrischen Stationen in Deutschland 966.000 Fälle behandelt - ein Anstieg von 28 Prozent binnen zehn Jahren. Die Zahl der Psychiatriebetten stieg im gleichen Zeitraum um 13 Prozent an. Das ist besonders auffällig, weil parallel die Zahl der Betten auf anderen Krankenhausstationen um rund zehn Prozent sank. Am deutlichsten aber ist der Anstieg bei den Antidepressiva: Zwischen 2005 und 2014 verdoppelte sich deren Verbrauch in Deutschland nahezu. Im vergangenen Jahr wurden 1,4 Milliarden Tagesdosen verschrieben, das bedeutet umgerechnet: Rund 3,8 Millionen Menschen nehmen ein Jahr lang täglich ein Antidepressivum.
Werden wir ein Volk von Psychopathen und Schwermütigen? Oder macht uns der Medizinbetrieb dazu?
Während überall sonst im Krankenhaus, egal ob auf der Chirurgie, bei der Inneren Medizin, der Geburtshilfe oder der Neurologie heute nach Fallpauschalen abgerechnet wird, nach so genannten Diagnosed Related Groups (DRGs), gibt es in der Psychiatrie diese Pauschalen noch nicht. Da zählt noch der gute alte Pflegesatz aus der Zeit, bevor Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) das Klinikwesen zusammen mit ihrem Parteigenossen Karl Lauterbach reformierte.
Ein Krankenhaus erhielt 2014 pro Psychiatrie-Patient und Tag im Schnitt 240 Euro, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 400 Euro, in der Psychosomatik, dem bevorzugten Ort von Burn-out-Patienten, knapp 200 Euro. Verständlich also, dass die Kliniken Psychiatrie-Patienten gern aufnehmen.
Einen zweiten Grund für den Zulauf nennt Professor Mathias Berger, Ärztlicher Direktor in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Freiburg. Seine Diagnose: Die niedergelassenen Ärzte sind "massiv unterfinanziert", wenn sie psychiatrische Patienten behandeln. So könne ein Hausarzt gerade mal 35 Euro im Quartal für die Behandlung eines Patienten abrechnen, ein Facharzt für Psychotherapie 50 bis 70 Euro. Plätze bei Psychotherapeuten dagegen sind rar, man muss oft monatelang auf seine Therapie warten. Also bleiben die niedergelassenen Ärzte übrig, für die sich die Behandlung nicht lohne und die deshalb die Patienten in die Kliniken überweisen.
"Weil das ambulante Versorgungssystem so saumäßig schlecht ist, drängen die Patienten in die Kliniken", konstatiert Professor Berger. "Das jetzige Abrechnungssystem verdonnert die Ärzte zu einer ganz miesen Medizin."
Berger hält viel von den regionalen Psychiatriebudgets, wie sie Matthias Heißler in Geesthacht praktiziert. "Auf ein Viertel der Psychiatrie-Betten könnte man verzichten", sagt Berger, wenn solche Alternativmodelle bundesweit umgesetzt würden.
Sein Kollege Ingmar Steinhart, Professor am Institut für Sozialpsychiatrie in Greifswald, glaubt sogar, man könne rund die Hälfte der Psychiatrie-Betten in Deutschland einsparen. "Und das ist für die Patienten mindestens gleich gut oder besser als im Krankenhaus behandelt zu werden." Die Hälfte der Psychiatriebetten einsparen - das bedeutet, dass in Deutschland heute mehrere hunderttausend Patienten ohne medizinische Notwendigkeit in Psychiatrien gehalten werden.
Aber es sind Patienten, die keine Lobby haben in einem Gesundheitswesen, in dem sonst jede Kleingruppe erfolgreich ihre Interessen durchzusetzen versucht.
Psychiatrische Betten im Jahr 2003
Spitzenreiter: Im Stadtstaat Bremen gab es im Jahr 2003 genau 106 Psychiatriebetten pro 100.000 Einwohner. Auf den nächsten Plätzen folgten Schleswig-Hostein und Nordrhein-Westfalen mit 90 Betten. Die geringste Zahl von Psychiatriebetten gab es damals mit jeweils 60 pro 100.000 Einwohner in Rheinland-Pfalz.
Psychiatrische Betten im Jahr 2013
Fast überall in Deutschland stieg die Zahl der Psychiatrie-Betten in den vergangenen zehn Jahren kräftig: Spitzenreiter ist heute Schleswig-Holstein mit 101 Psychiatriebetten pro 100.000 Einwohner, auf den nächsten Plätzen folgen Bremen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Mit den wenigsten Betten kommt Hessen aus.
Regionale Psychiatriebudgets
400 Stadt- und Landkreise gibt es in Deutschland, aber nur in rund einem Dutzend haben die Krankenkassen regionale Psychiatriebudgets genehmigt. Schwerpunkt ist Schleswig-Holstein. Geesthacht zum Beispiel kommt heute nach eigenen Angaben mit 10 Psychiatriebetten pro 100.000 Einwohner aus - während der Bundesschnitt bei 90 Betten liegt.
Es gibt rund 400 Stadt- und Landkreise in Deutschland, aber nur in einem Dutzend werden Alternativmodelle zur Krankenhauspsychiatrie praktiziert. Der Pionier dieser Projekte war im Jahr 2003 Arno Deister, Chefarzt des Zentrums für Psychosoziale Medizin am Klinikum Itzehoe und künftig auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), der größten und ältesten Fachgesellschaft für Psychiater in Deutschland.
Auch Deister hat die Zahl der Betten in seinem Krankenhaus drastisch reduziert, nachdem ihm die Krankenkassen Budgetfreiheit gewährten. 2003 gab es in Itzehoe noch 118 Psychiatriebetten, heute sind es gerade einmal halb so viele. "Ein leeres Bett ist in der Psychiatrie ein Widerspruch in sich", sagt Deister und lächelt. Sobald ein Bett leer ist, findet ein Krankenhaus auch einen Patienten, der reinpasst.
Psychiatrische Patienten brauchen aber nicht zuallererst ein Bett, sagt Deister, sondern eine individuelle Behandlung. "Störungen sind immer auch Störungen im sozialen Umfeld. Man kann einen Patienten nur erfolgreich behandeln, wenn man dieses Umfeld mit berücksichtigt." Deister sagt, er behandle die Hälfte seiner Schizophrenie-Patienten inzwischen ambulant. "Warum? Weil wir heute nicht mehr finanziell dafür bestraft werden, wenn wir einen Patienten nicht im Krankenhaus behandeln."
Die Krankenkassen bekämen in Deutschland eben das geliefert, was sie bezahlen. "Sie bezahlen die Übernachtung im Krankenhaus, also bekommen sie die Übernachtung im Krankenhaus geliefert."
Als Deister im Jahr 2003 als erster in Deutschland mit einem regionalen Psychiatriebudgets angefangen hat, war die Skepsis unter den Kollegen groß, ob das wirklich etwas bringt. Deshalb sollte eine begleitende Studie ermitteln, wie nützlich das "Home-Treatment", die ambulante Behandlung zu hause, tatsächlich ist. Forscher der Uni Leipzig verglichen also 258 Patienten aus Deisters Landkreis mit 244 aus dem Nachbarkreis Dithmarschen. Das Ergebnis, 2010 in der Fachzeitschrift "Psychiatrische Praxis" veröffentlicht: Die Kosten waren gleich, der Krankheitsverlauf ähnlich, "aber das Funktionsniveau der Patienten besserte sich in der Modellregion stärker". Mit anderen Worten: Die Patienten waren besser in ihr soziales Umfeld integriert und konnten ihren Lebensalltag selbständig bewältigen.
Auch Professor Steinhart von der Uni Greifwald hat die Forschung zum "Home-Treatment" ausgewertet und zog im vergangenen Jahr in einer Fachzeitschrift Bilanz. Das Ergebnis: Bei Patienten, die zu hause behandelt wurden, gab es weniger Behandlungsabbrüche, geringere Kosten und Patienten und Angehörige waren zufriedener.
Am ausführlichsten mit dem Nutzen des "Home-Treatments" haben sich aber die Verfasser der S3-Leitline "Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen" befasst. Die Leitlinie stammt von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, bündelt den wissenschaftlichen Forschungsstand und soll Ärzten eine Richtschnur sein, wie Psychiatrie-Patienten idealerweise behandelt werden. Die besten Studien zeigen demnach, dass jene Patienten, die von mobilen Teams zu hause behandelt werden:
- seltener erneut das Krankenhaus aufsuchen
- seltener ihre Behandlung abbrechen
- mit der Behandlung zufriedener sind als die anderen
- die Angehörigen weniger belasten
- die Angehörigen eine stärkere Verhaltensänderung feststellten.
Insgesamt, folgert die S3-Leitlinie, seien mobile Behandlungsteams und eine Betreuung zu Hause "einer herkömmlichen Behandlung überlegen". Die klare Empfehlung: weniger stationäre Aufnahmen. Das nüchterne Fazit: "Deutschland bleibt hinter dem Entwicklungsstand in anderen Ländern zurück." Schließlich gibt es hierzulande gerade mal in zwei bis drei Prozent aller Landkreise die Freiheit eines Regionalbudgets und die Möglichkeit, Home-Treatment-Modelle einzuführen.
Psychiatrie in Deutschland findet weiter in Klinikbetten statt.
Die Geschichte der Psychiatrie in Deutschland ist ein dunkles Kapitel. Im Dritten Reich kürzten die Nationalsozialisten die Versorgung der Psychiatrien planvoll so stark, dass die Lebensmittel nicht mehr ausreichen konnten. So setzte in den 1940er Jahren ein organisiertes Hungersterben ein, bei dem jedes Jahr bis zu 30 Prozent der Patienten grausam verendeten. Vor allem die Verantwortlichen in Sachsen, Bayern und Hessen betrieben eine radikale Hungerpolitik. Nach Recherchen des Arztes und Historikers Heinz Faulstich fielen von 1939 bis 1945 insgesamt 185.000 psychisch Kranke der NS-Vernichtungspolitik zum Opfer.
Auch in der frühen Bundesrepublik war es besser, nicht in einer Psychiatrie zu landen. Patienten wurden damals schlicht weggesperrt und verwahrt, von einer Therapie konnte kaum die Rede sein. Während Patienten heute im Durchschnitt zwölf Tage auf Station bleiben, befand sich ein Patient in der Bundesrepublik des Jahres 1975 noch durchschnittlich 250 Tage in stationärer Behandlung. Fast ein Drittel der Patienten lebte damals länger als zehn Jahre auf psychiatrischen Stationen.
Der Bericht der Bundestags Enquetekommission Psychiatrie im Jahr 1975, aus dem diese Zahlen stammen, führte schließlich zu einer neuen "Psychiatrie-Personalverordnung", die die Zahl der Ärzte und Pflegekräfte deutlich erhöhte und kaum verändert bis heute gilt.
Zu Besuch in der größten Psychiatrie Deutschlands, dem Isar Amper Klinikum in München Haar, dessen Wurzeln ins Jahr 1912 reichen, als die "Oberbayerische Kreisirrenanstalt Haar" mit 900 Betten gegründet wurde. Die größten Psychiatrien in Deutschland wurden weit weg von städtischen Zentren gebaut und stehen deshalb noch heute in Kleinstädten wie Wiesloch, Emmendingen, Wasserburg, Königslutter oder Winnenden.
Auch das Isar Amper Klinikum liegt mit seinen 1176 psychiatrischen Betten eine halbe Autostunde von der Münchner Innenstadt entfernt - ein parkähnliches Gelände, das einem Dorf ähnelt. Es gibt viele einzelne Häuser, zum Teil Neubauten, zum Teil im alten Pavillonstil gebaut, mit Stationen, Wohnungen, Therapieräumen. Außerdem gibt es ein Café-Restaurant und einen kleinen Supermarkt, beides betrieben von Menschen mit psychischen oder sozialen Problemen, zwei Kirchen und sogar einen Friedhof. Das Gutshof-ähnliche Hauptgebäude mit der Verwaltung und Patientenaufnahme sieht altehrwürdig aus, Efeu rankt sich bis unters Dach an der Hausmauer empor. Überall ist Baulärm zu hören, das Klinikum Haar wird eigentlich immer um- und ausgebaut.
Dass die Zahl der Betten im Isar-Amper-Klinikum in den letzten Jahren gestiegen ist, erklärt Margitta Bormann-Hassenbach, Vorstand Medizin des Klinikums, damit, dass München wächst, während die Zahl der niedergelassenen Psychiater nicht mitwachse. Außerdem habe sich das "Inanspruchnahmeverhalten der Menschen" geändert: "Depressionen und hierbei insbesondere die Verbindung mit Burn-out ist manchen Schichten fast ein must-have", sagt Bormann-Hassenbach. Klinikgeschäftsführer Jörg Hemmersbach ergänzt: "Wir gehen ja schon davon aus, dass der Patient, der zu uns kommt, auch krankenhausbedürftig ist. Aber ich wollte auch mal eine Station auflösen, das Budget behalten und Home-Treatment machen. Aber das war mit den Krankenkassen nicht verhandelbar."
Dass die Krankenkassen sich gegen das medizinisch sinnvolle Home-Treatment wehren, hört man immer wieder. Paul Bomke, Geschäftsführer des Pfalzklinikums, das in zwölf Städten und Gemeinden in der Pfalz 496 Betten für psychiatrische Patienten unterhält, sagt, auch er hätte gern ein regionales Psychiatriemodell eingeführt. "Aber wir haben nach fünf Jahren Verhandlungen mit den Kassen genervt aufgegeben. Es hat uns einfach die pure Ignoranz und die pure Angst entgegengeschlagen."
Warum sind die Krankenkassen so skeptisch gegenüber den regionalen Budgets? Fragen wir Wulf-Dietrich Leber. Er leitet beim Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen in Berlin die Abteilung Krankenhäuser und ist so etwas wie die graue Eminenz der Krankenhausfinanzierung. Zu dem Thema hat er etliche Aufsätze geschrieben. (https://www.gkvspitzenverband.de/krankenversicherung/krankenhaeuser/psychiatrie/fakten_analysen/fakten_analysen.jsp)
Leber sagt, er habe "große Schwierigkeiten" mit den regionalen Budgets. "Die Krankenkassen sollen Geld geben und dann die Augen zu machen." Sie hätten keine Kontrolle darüber, was mit dem Geld passiert, ob die mobilen Teams wirklich aufgebaut werden und wie gut sie die Patienten betreuen. "Das Vergütungsprinzip sollte nicht lauten: ambulant behandeln und stationär kassieren. Die Regionalbudgets laden zu Missbrauch ein. Das Modell geht eigentlich nur, wenn ich auch ein Qualitätssicherungssystem einbaue." Die wissenschaftlichen Studien, die zeigen, dass "Home-Treatment" mindestens so erfolgreich sei wie eine Behandlung in der Klinik, überzeugen ihn nicht, sagt Leber.
Mit dem jetzigen System sind die Krankenkassen aber auch nicht zufrieden. "Wir haben ein Vergütungssystem, das zur Maximierung von Pflegetagen führt und zur Maximierung von Betten", sagt Leber. "Was ich jetzt habe, ist ein Anreiz, die Leute lange zu behalten statt sie möglichst schnell zu therapieren."
Der Vorschlag der Krankenkassen: Sie wollen das Fallpauschalen-System (DRG) auch auf die Psychiatrie übertragen - was nahezu allen Psychiatern den Kamm schwellen lässt. Psychische Erkrankung sollen nach Schweregraden sortiert und pauschal abgerechnet werden. "Pauschalierendes Entgeltsystem Psychiatrie und Psychosomatik" nennt sich das neue System, kurz PEPP. Im Jahr 2013 hat das Gesundheitsministerium PEPP in Kraft gesetzt, ursprünglich sollten alle Psychiatrien bis Ende 2016 darauf umgestellt werden. Nach massiven Protesten wurde die Übergangsphase bis 2018 verlängert, gleichzeitig soll das System noch mal grundsätzlich überprüft werden.
Einer der schärfsten Gegner der neuen Pauschalen ist ausgerechnet ein Politiker, der bisher eher eine gewisse Nähe zu den Krankenkassen gezeigt hat und einer der größten Befürworter der DRGs bei ihrer Einführung war: Professor Dr. Karl Lauterbach, Mediziner, Gesundheitspolitiker und Vize-Chef der SPD-Bundestagsfraktion.
Lauterbach empfängt im Berliner Abgeordnetenhaus am Reichstag. Er ist überzeugt, dass die geplanten PEPP-Pauschalen "schwerwiegende und nicht leicht revidierbare Nachteile für psychisch Kranke" mit sich bringen. Er führt den Widerstand in der SPD-Fraktion an, aber es werde "keine leichte Aufgabe, das PEPP-System in der Großen Koalition zu verhindern."
Warum kämpft Lauterbach so entschieden gegen PEPP? "Es gibt in keinem Land der Welt Psychiatrie-Fallpauschalen", sagt der SPD-Politiker, "und das aus gutem Grund, weil es in der Psychiatrie keine klaren Diagnosegruppen geben kann." Die Folgen seien verheerend, wenn PEPP wie geplant umgesetzt werde: Die Krankenhäuser würden sich die lukrativen Patienten herauspicken, die einfachen Fälle, für die man volle Pauschale kassieren könne. "Und die schwierigen Patienten werden dann weiter gereicht wie eine heiße Kartoffel." Das PEPP-System werde "dazu beitragen, das jetzige nicht-funktionale System zu betonieren."
Auch Lauterbach ist überzeugt, dass die regionalen Budgets am besten für die Patienten wären. Die Kliniken bräuchten den Freiraum, das Geld so einzusetzen, wie sie es für richtig halten. "Viele Psychiatrie-Patienten werden aus finanziellen Gründen im Krankenhaus gehalten, nicht aus medizinischen", räumt der SPD-Politiker ein.
Anfang September haben 16 Fachgesellschaften, darunter auch die DGPPN, eindringlich an Gesundheitsminister Hermann Gröhe appelliert, das PEPP-Modell in seiner jetzigen Form zu verhindern. Sie haben als Alternative ein Modell tagesbezogener Pauschalen vorgeschlagen. Es ist herrlich kompliziert und lässt sich deshalb wunderbar ins deutsche Gesundheitssystem einfügen. Der dahinter stehende Gedanke ist aber dennoch richtig. "Das Geld muss sich von den Betten lösen", sagt der künftige DGPPN-Präsident Deister. Ob das Modell eine Chance hat oder ob Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) im Verbund mit den Krankenkassen die Psychiatrie-DRGs durchdrückt, entscheidet sich noch 2015.
Aber kann man wirklich alle Patienten aus den Psychiatrien entlassen? "Nein", sagt selbst Matthias Heißler, der wohl radikalste Psychiatrie-Reformer in Deutschland. Der Chefarzt hat in seinem Klinikum zwar zwei Drittel der Psychiatrie-Betten abgebaut - aber eben nur zwei Drittel und nicht alle. Manche Patienten müssten auch mal raus von Zuhause, auch zum Schutz von Angehörigen. Das Überraschende ist aber, dass Heißler selbst die Hälfte der gerichtlich zwangseingewiesenen Patienten nicht auf seiner kleinen Station behält, sondern sie noch am gleichen Tag oder wenig später nach Hause entlässt.
Wie traumatisierend so eine Zwangseinweisung sein kann, schildert Frau J. Die 52-jährige litt an einer schizophrenen Psychose, sie hörte Stimmen und wurde vor zehn Jahren mit Beschluss eines Amtsrichters in eine Psychiatrie in Hamburg eingewiesen. "Ich hatte mich aus Leibeskräften gewehrt, ich wollte nicht in die Klinik, ich wollte ambulant behandelt werden, aber die Polizei kam und hat mich überwältigt." Ein Verein junger Anwälte, der Psychiatriepatienten vertritt, habe sich um sie gekümmert. "Das war das erste Mal, dass ich zwangseingewiesen wurde. Da ist alles vergittert, da werden sie mit fremden Menschen zusammen gesperrt, mit abgenommenen Türklinken und verriegelten Fenstern, ich hatte permanent Angst, auch vor den anderen Patienten", erinnert sich die Frau. "Ich wollte auch keine Medikamente nehmen. Aber sie haben mir gesagt, dass meine Tochter mich dann nicht besuchen dürfe. Deshalb musste ich die Psychopharmaka dann doch nehmen. So was möchte ich nie wieder erleben."
Nach einem Monat kam Frau J. von der geschlossenen Abteilung in die offene, nach weiteren zwei Monaten wurde sie entlassen.
Anfang 2015 erlitt sie einen Rückfall. Inzwischen wohnte sie nicht mehr in Hamburg, sondern im Herzogtum-Lauenburg, im Einzugsgebiet von Matthias Heißler. "Ich habe in der Klinik angerufen, und er kam sofort zu mir. Er ist sogar zu meinen Eltern gefahren und hat mich überzeugt, ein bestimmtes Medikament zu nehmen. Wenn ich will, kann ich auch einen ganzen Tag in der Klinik verbringen, das habe ich schon ein paar mal gemacht, aber abends bin ich immer nach Hause gefahren."
Heißler sagt, es sei wichtig, die Menschen in ihrem Umfeld zu betreuen. Frau J. habe es zum Beispiel versäumt, sich krankschreiben zu lassen. Auf so was achte er, wenn er Patienten zu hause aufsuche. Also habe er die Krankschreibung an die Firma geschickt. Hätte Frau J. wochenlang unentschuldigt gefehlt, hätte ihr Arbeitgeber ihr vermutlich gekündigt. Und ihre Lage wäre danach vermutlich noch schlimmer geworden.
Mit dem Geld, das Heißler durch den Abbau der Klinikbetten einspart, hat er mehrere Sozialarbeiter eingestellt, er beschäftigt Ergotherapeuten, betreibt ein Wasch-Café als Anlaufstelle, einen Second-Hand-Laden als Arbeitsstätte für Patienten und hilft ihnen bei der Wohnungssuche.
Und einen Patienten hat er, ganz nebenbei und obwohl das nicht zu seinem Fachgebiet gehört, von seinem Rückenleiden kurieren können. Ganz einfach deshalb, weil er gesehen hatte, auf was für einer durchgelegenen Matratze der Mann jede Nacht schlief.