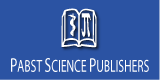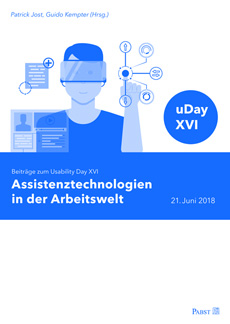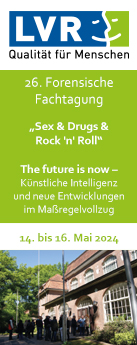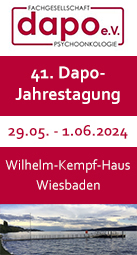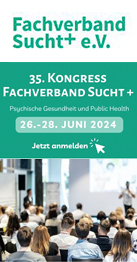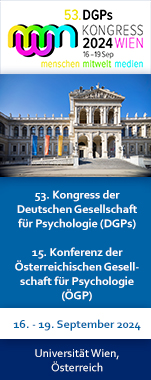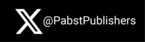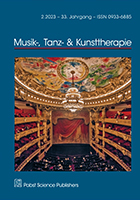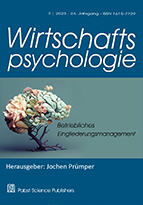Kempter und Kollegen illustrieren das Grundproblem anhand eines einfachen Experiments: Ein Roboter reicht Besuchern ein Glas Orangensaft. In der ersten Variante führt er die Bewegung in einer fast menschlichen, leicht geschwungenen Weise aus. In der zweiten Variante bewegt sich der Roboterarm auf kürzestem, absolut geradlinigen Weg auf den Besucher zu. Die genaue Vergleichsmessung der Reaktionszeiten ergibt: In der "menschenähnlichen", ersten Versuchsanordnung nehmen die Besucher das Glas sofort, in der zweiten, robotermäßigen Variante zögern sie leicht.
Dorothea Erharter macht in ihrem Beitrag zum Reader auf ein bisher kaum beachtetes Defizit aufmerksam: Technologische Innovationen werden weltweit vorwiegend von weißen Männern im mittleren Lebensalter entworfen, auch wenn die meisten Anwender anderen Bevölkerungsgruppen angehören. Erharter hält es für erwiesen, dass Entwicklergruppen mit Männern und Frauen unterschiedlicher Generationen die marktgerechteren technologischen Innovationen realisieren. Als Hinweis beschreibt die Autorin ein neues Konzeptcar, das von Designerinnen entworfen wurde und sich grundlegend von existierenden PKWs unterscheidet. Den Designerinnen war entscheidend wichtig:
- gute Sichtverhältnisse in alle Richtungen
- gutes Handling und Manövrierbarkeit
- Bequemlichkeit im Innenraum
- leicht zu ereichende Bedienelemente, leicht lesbare Armaturen
- leichtes Ein- und Aussteigen
- Einfaches Einparken
Dorothea Erharter sieht in der Gender Diversity von Entwicklungsverantwortlichen bisher ungenutzte weitreichende Innovationspotentiale, die sowohl weiblichen als auch männlichen Nutzern zugute kommen können.
Patrick Jost, Guido Kempter (Hrsg.) Assistenztechnologien in der Arbeitswelt. Pabst 2018, 232 Seiten. Paperback ISBN 978-3-95853-405-6. e-Book ISBN 978-3-95853-406-3