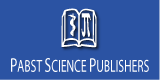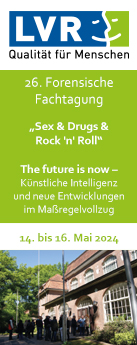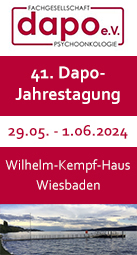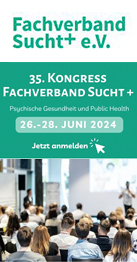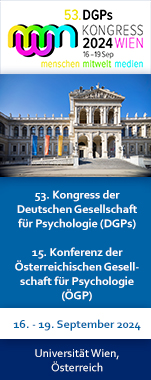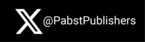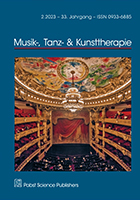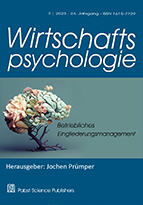Inhaltsverzeichnis
Editorial
Bernd Bösel
Raum, Psyche, Technik und Kritik: Zu Gilbert Simondons Begriff der ›Einfügung‹ und seinem gesellschaftskritischen Potenzial
Rebekka Atakan
Dimensionen der Raumwahrnehmung – eine relationale Analyse in Vierteln im Gentrifizierungsprozess
Fiona Kalkstein, Natalie Gittner & Julia Schuler
Wie viel Differenz verträgt Heimat? Raumbindung und Konflikte um kommunale Gestaltung und lokale Zugehörigkeit
Tobias Reuss & Gero Menzel
Schall und Raum. Lautes Denken als raumsensible Methode
Autor:innen dieses Heftes
Editorial
Katharina Hametner & Markus Wrbouschek
Raum, Psyche, Technik und Kritik: Zu Gilbert Simondons Begriff der ›Einfügung‹ und seinem gesellschaftskritischen Potenzial
Bernd Bösel
Menschen werden heute in vielfach vorstrukturierte, gebaute und atmosphärisch bewusst gestaltete Räume hineingeboren. Worauf aber beruht diese menschliche Fähigkeit zur Raumgestaltung? Dieser Frage wird mithilfe der philosophischen Anthropologie sowie mit Gilbert Simondons Technikphilosophie nachgegangen. Letztere postuliert in ihrem historischen Teil eine prähistorische ›magische Welt‹, die von ›begünstigen Orten‹ beherrscht gewesen sei, die dem menschlichen Milieu eine netzwerkartige Struktur gaben. Erst durch das Aufbrechen derselben seien die Bereiche der Technik und der Religion entstanden. Mithilfe des Atmosphärenbegiffs der Neuen Phänomenologie wird dies einerseits weiter ausgeführt, andererseits die zeitgenössische, tendenziell die gesamte Erdoberfläche betreffende Raumverfügung einer Kritik unterzogen. Als Schlüsselbegriff mit einem weitreichenden gesellschaftskritischen Potenzial erweist sich Simondons ästhetischer Begriff der ›Einfügung‹, insofern dieser die Grenze technischer Verfügung markiert. Der Artikel
endet mit einem Plädoyer für die Stärkung einer Ortssensibilität im Umgang mit Technik und Raum.
Schlagwörter: magische Welt, Technizität, Limitation, Atmosphäre, Einfügung
Dimensionen der Raumwahrnehmung – eine relationale Analyse in Vierteln im Gentrifizierungsprozess
Rebekka Atakan
Im Zuge von Gentrifizierungsprozessen kommt es in Nachbarschaften zu einer Koexistenz alteingesessener und neuzugezogener Bewohner*innen. In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, ob sich innerhalb dieser Personengruppen kollektive Muster der Raumwahrnehmung feststellen lassen, um daraus Rückschlüsse über divergierende Raumbedürfnisse und -aneignungspraktiken sowie mögliche Tendenzen kultureller Verdrängung zu ziehen. Anhand von Daten der 5. Welle des Kölner Wohnungspanels aus dem Jahr 2022 (N=915) werden Raumwahrnehmungen und -bewertungen der Bewohner*innen zweier Kölner Gentrifizierungsgebiete mithilfe der multiplen Korrespondenzanalyse in einen zweidimensionalen Raum projiziert. Durch die Verortung soziodemographischer Merkmale in diesem ›Raum der Raumwahrnehmungen‹ kann gezeigt werden, dass langjährige Bewohner*innen ihre Nachbarschaft primär anhand sozialer Merkmale charakterisieren, während Neuzugezogene baulich-infrastrukturelle Elemente priorisieren. Baulich-infrastrukturelle Anpassung an die Bedürfnisse der Neuzugezogenen werden in beiden Nachbarschaften als konfliktives Moment ermittelt, das die Alteingesessenen von den Neuzugezogenen trennt und als Ausdruck kultureller Verdrängung interpretiert wird.
Schlagwörter: Raumwahrnehmung, multiple Korrespondenzanalyse, Gentrification, kulturelle Verdrängung
Wie viel Differenz verträgt Heimat?
Raumbindung und Konflikte um kommunale Gestaltung und lokale Zugehörigkeit
Fiona Kalkstein, Natalie Gittner & Julia Schuler
Der vorliegende Beitrag stellt Teilergebnisse eines psychoanalytischsozialpsychologischen Forschungsprojektes über zivilgesellschaftliches Engagement in einer sächsischen Kleinstadt dar. In der Stadt findet sich eine rege und engagierte Zivilgesellschaft, während gleichzeitig auch extrem rechte Akteure ihre Mobilisierungsfähigkeit unter Beweis stellen. Mit Akteuren der Zivilgesellschaft wurden Gruppendiskussionen geführt. Trotz mehrfacher Versuche gelingt es der demokratischen Zivilgesellschaft nicht, sich gemeinsam und entschlossen gegen die extreme Rechte zu stellen. Vielmehr verliert sie sich in zerfaserte politisch-ideologische Konflikte untereinander. Dabei spielt der kommunale Raum eine zentrale Rolle: Entlang der Achsen Zugehörigkeit (Differenz vs. Homogenität) und Gestaltung (Veränderung vs. Konservierung) blockieren sich die Akteure gegenseitig. Die Ergebnisse werden mit Konzepten der Heimat, Identität und Zugehörigkeit analytisch in Verbindung gebracht.
Schlagwörter: Heimat, Provinz, Identität, Differenz, Psychoanalyse, Sozialforschung
Schall und Raum. Lautes Denken als raumsensible Methode
Tobias Reuss & Gero Menzel
Aufbauend auf einem empirischen Forschungsprojekt zur neuen Frankfurter Altstadt reflektieren wir die epistemologischen, methodologischen und methodischen Fragestellungen einer psychoanalytisch inspirierten Analyse von Raum. Ausgangspunkt bildet eine interaktionstheoretisch reformulierte Psychoanalyse Alfred Lorenzers. Daraus entwickeln wir, wie individuelles Raumerleben für eine Analyse der symbolischen Potentiale des Raumes nutzbar gemacht werden kann. Dabei greifen wir bisherige Ansätze auf, um unsere Methodik herauszubilden. Anschließend diskutieren wir sie vergleichend mit Ansätzen der Walking Interviews. Wir schließen den Artikel mit einer Kurzdarstellung des Forschungsprojekt und den Potentialen einer psychoanalytisch inspirierten Methode.
Schlagwörter: Tiefenhermeneutik, Architektur, Lautes Denken, Raum, Walking Interviews
Psychologie & Gesellschaftskritik
47. Jahrgang • 2023 • Heft 3 (187)
Pabst, 2023
ISSN 0170-0537